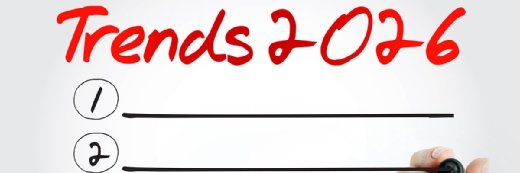NicoElNino - Fotolia
Storage-Anforderungen für KI-Workloads im Überblick
Storage-Systeme und Speichernetzwerke für KI-Workloads müssen verschiedene und anspruchsvolle Anforderungen erfüllen. Wir erklären die wichtigsten Parameter für KI-fähigen Speicher.
Künstliche Intelligenz (KI) beziehungsweise deren Anwendungen und Workloads sind auf die Verarbeitung großer Datenmengen angewiesen – sei es beim Training von Modellen oder bei der Inferenz. Deshalb kommt Speichernetzwerken und -systemen eine zentrale Rolle zu: Sie ermöglichen die strukturierte Ablage, sichere Verwaltung und schnelle Verfügbarkeit von Daten, ohne dabei Integrität oder Konsistenz zu gefährden.
Gerade bei rechenintensiven Trainingsprozessen ist ein schneller, latenzarmer Datenzugriff entscheidend. Speichersysteme müssen große Datenmengen effizient handhaben und sich gleichzeitig flexibel und nahtlos skalieren lassen.
Skalierbare Speicherarchitekturen für datenintensive Workloads
Um den wachsenden Anforderungen moderner KI-Anwendungen gerecht zu werden, sind skalierbare Speicherlösungen unerlässlich. Verteilte Dateisysteme oder objektbasierte Speicherplattformen bieten die nötige Flexibilität und Performance, um Multi-Node-Umgebungen effizient zu unterstützen – insbesondere während der Konsolidierung großer Datenmengen.
Nur durch die Optimierung der zugrunde liegenden Infrastruktur lassen sich KI-Workflows voll ausschöpfen. Investitionen in performante Speichernetzwerke zahlen sich aus: Sie verbessern die Gesamtleistung und ermöglichen eine beschleunigte Modellentwicklung sowie deren reibungslose Bereitstellung – ein klarer Wettbewerbsvorteil für Unternehmen.
Was KI-Speichernetzwerke leisten müssen
Speicherumgebungen für KI-Workloads müssen verschiedene Leistungsparameter aufweisen und nicht nur eine Anforderung bedienen. Wir haben die wichtigsten Leistungsmerkmale nachfolgend in Kürze zusammengefasst.
Datenübertragung ohne Verzögerung
KI-Anwendungen benötigen Hochleistungsverbindungen: Eine Kombination aus hoher Bandbreite und geringer Latenz ist entscheidend, um Daten rasch zwischen Speicher und Rechenressourcen zu verschieben – ein Muss für effizientes Training und Inferenz.
Speicher, der mitwächst
Mit zunehmender Modellkomplexität steigen auch die Datenmengen. Skalierbare Speicherarchitekturen wie verteilte Dateisysteme oder Objektspeicher bieten die nötige Flexibilität, um sowohl Kapazität als auch Leistung linear zu erweitern.
Zugriff auf Daten – parallel und performant
KI-Workloads profitieren von paralleler Verarbeitung. Deshalb sollten Speichernetzwerke mehrere gleichzeitige Zugriffe ermöglichen, damit Daten effizient verarbeitet und Modelle schneller trainiert werden können.
Reibungslose Datenbewegung und Sicherung
Mechanismen für Datenmigration, -replikation und -synchronisation sind unerlässlich – besonders in hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen. Snapshots und Backups sichern kritische Trainingsdaten und schützen vor Datenverlust.
Unterstützung vielfältiger Datenformate
KI-Anwendungen verarbeiten strukturierte, unstrukturierte sowie Multimedia- und Sensordaten. Entsprechend muss das Speichernetzwerk verschiedenste Dateitypen unterstützen – inklusive großer Medieninhalte, die speziellen Codec-Standards unterliegen.
Gemeinsame Datennutzung ermöglichen
Damit Teams effizient zusammenarbeiten können, müssen Netzwerke kollaboratives Arbeiten an gemeinsamen Datensätzen ermöglichen – ohne Performanceeinbußen.
Integration über verschiedene Infrastrukturen hinweg
Viele Unternehmen nutzen hybride oder Multi-Cloud-Umgebungen. Ein gutes Speichernetzwerk integriert sich reibungslos in lokale Systeme und Cloud-Dienste und unterstützt die sichere Synchronisation sowie zentrale Governance-Richtlinien.
Speicher-Array oder disaggregierte Architektur?
Es gibt verschiedene Storage-Architekturen, die sich für KI-Workloads einsetzen lassen. Die Entscheidung hängt von den spezifischen Anforderungen der KI-Anwendungen ab. Benötigen Unternehmen kurze Latenzzeiten, so sind Arrays die bessere Wahl. Wer eine flexiblere Skalierbarkeit und optimale Ressourcenauslastung benötigt, für den ist wahrscheinlich disaggregierter Speicher die richtige Lösung. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze sind hier kurz erläutert.
Klassisch, zentralisiert: Speicher-Arrays
Speicher-Arrays bestehen aus einem zentralen Controller und mehreren Laufwerken. Sie bieten hohe IOPS, geringe Latenz und vereinfachte Verwaltung über zentrale Steuerung. Typische Funktionen sind RAID, Snapshots, Replikation und Deduplizierung.
Skalierbarkeit erfolgt durch zusätzliche Laufwerke oder Module – allerdings nur im Rahmen der Kapazitätsgrenzen des Systems. Zudem besteht die Gefahr von Ressourcensilos, bei denen Speicher nur einzelnen Servern zugewiesen ist. Das kann die Auslastung begrenzen und den parallelen Datenzugriff erschweren.
Flexibel und skalierbar: Disaggregierter Speicher
Disaggregierter Speicher entkoppelt Speicher und Rechenleistung. Über ein Netzwerk wird eine gemeinsame Speicherebene bereitgestellt, die von vielen Servern gleichzeitig genutzt werden kann.
Die Vorteile: Unabhängige Skalierbarkeit von Speicher und Rechenressourcen, optimierte Ressourcenauslastung, weniger Silos und eine höhere Flexibilität bei der Hardwarewahl. Dank Technologien wie RDMA wird ein schneller, paralleler Datenzugriff möglich – ideal für datenintensive KI-Prozesse.
Diese Architektur erlaubt dynamisches Anpassen an wechselnde Workload-Anforderungen und fördert die Effizienz über Projektgrenzen hinweg – besonders bei unternehmensweiten KI-Initiativen.
Trends im Storage für KI-Workloads
Während sich die grundlegenden Anforderungen an Speicherlösungen für KI-Workloads in den letzten Jahren kaum verändert haben – hohe I/O-Performance, Skalierbarkeit und die Fähigkeit, große Mengen unstrukturierter Daten effizient bereitzustellen –, zeichnen sich inzwischen neue Entwicklungen ab, die den Einsatz von KI in Unternehmen weiter prägen. Im Zuge der raschen Fortschritte bei generativer KI und komplexen ML-Anwendungen rücken innovative Speicherarchitekturen, erweiterte Sicherheitskonzepte und die Integration von KI-gestützten Automatisierungsfunktionen zunehmend in den Mittelpunkt. Diese Trends setzen auf den bestehenden Prinzipien auf, erweitern sie jedoch um zusätzliche Ebenen der Effizienz, Flexibilität und Resilienz, die für den produktiven und sicheren Betrieb moderner KI-Umgebungen unverzichtbar sind.
Retrieval-Augmented Generation (RAG) als Standardarchitektur
Retrieval-Augmented Generation (RAG) etabliert sich als zentrales Architekturprinzip für generative KI-Anwendungen. RAG kombiniert KI-Modelle mit einer Storage-geführten Datenanbindung, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit von KI-Ergebnissen zu verbessern. Unternehmen setzen zunehmend auf Speicherlösungen, die speziell für RAG-Workflows optimiert sind, um externe, vertrauenswürdige Datenquellen effizient in den KI-Prozess einzubinden und so Halluzinationen sowie Verzerrungen zu minimieren.
Next-Generation Data Protection: Cyberresilienz im Fokus
Mit der wachsenden Bedrohung durch Ransomware und andere Cyberangriffe rückt die nächste Generation der Datensicherung in den Vordergrund. Moderne Speicherlösungen bieten nicht nur klassische Backups, sondern integrieren prädiktive und präventive Schutzmechanismen, die Angriffe frühzeitig erkennen und eine schnelle Wiederherstellung ermöglichen. Damit wird die Cyberresilienz zum integralen Bestandteil der Speicherinfrastruktur.
Hybrid Multi-Cloud als Betriebsmodell
Unternehmen setzen verstärkt auf hybride Multi-Cloud-Architekturen, um die Vorteile von On-Premises- und Public-Cloud-Speicher zu kombinieren. Diese Strategie ermöglicht maximale Flexibilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit. Speicherlösungen werden häufiger softwaredefiniert bereitgestellt und sind über verschiedene Cloud-Umgebungen hinweg integrierbar.
Automatisierung und Optimierung durch KI
Der Trend zur Automatisierung setzt sich fort: Speicherinfrastrukturen werden intelligenter und selbstoptimierend konzipiert. Dabei wird künstliche Intelligenz in den Systemen selbst integriert, um bessere Funktionen und Leistungen für KI-Umgebungen bieten zu können. Diese KI-gestützten Systeme übernehmen Aufgaben wie Daten-Tiering, Kapazitätsplanung, Fehlererkennung und Performance-Optimierung. Ziel ist es, die Komplexität zu reduzieren, Energie- und Platzbedarf zu minimieren und die Effizienz der gesamten Speicherlandschaft zu steigern.
Modernisierung der Dateninfrastruktur
Die Konsolidierung und Vereinheitlichung der Speicherlandschaft steht im Vordergrund. Unternehmen streben eine einheitliche Verwaltung von Virtualisierungs-, Container- und klassischen Workloads an. Moderne Speicherplattformen bieten hierfür zentrale Steuerung, hohe Interoperabilität und unterstützen neue Workload-Typen, wie sie insbesondere durch KI und GenAI entstehen.
Diese Entwicklungen zeigen, dass Speicherlösungen im Jahr 2025 nicht mehr nur als passive Datenablage fungieren, sondern aktiv zur Effizienz, Sicherheit und Innovationskraft von KI-getriebenen Unternehmen beitragen.
Speicherinfrastruktur als Schlüssel zur KI-Power
Für den Erfolg von KI-Anwendungen ist ein leistungsfähiges Speichernetzwerk unverzichtbar. Es sollte hohe Bandbreiten, niedrige Latenzen und parallelen Zugriff bieten, um große Datenmengen effizient zu verarbeiten.
Skalierbare Architekturen wie verteilte Dateisysteme oder Objektspeicher sind essenziell, um mit dem Datenwachstum Schritt zu halten. Achten Sie bei der Auswahl der Infrastruktur auch auf Funktionen wie Datenvirtualisierung, Backup-Strategien und Governance-Kompatibilität.
Eine nahtlose Integration in hybride und Multi-Cloud-Umgebungen ermöglicht zudem Flexibilität, Skalierung und Zusammenarbeit – alles zentrale Faktoren für den Erfolg Ihrer KI-Projekte.