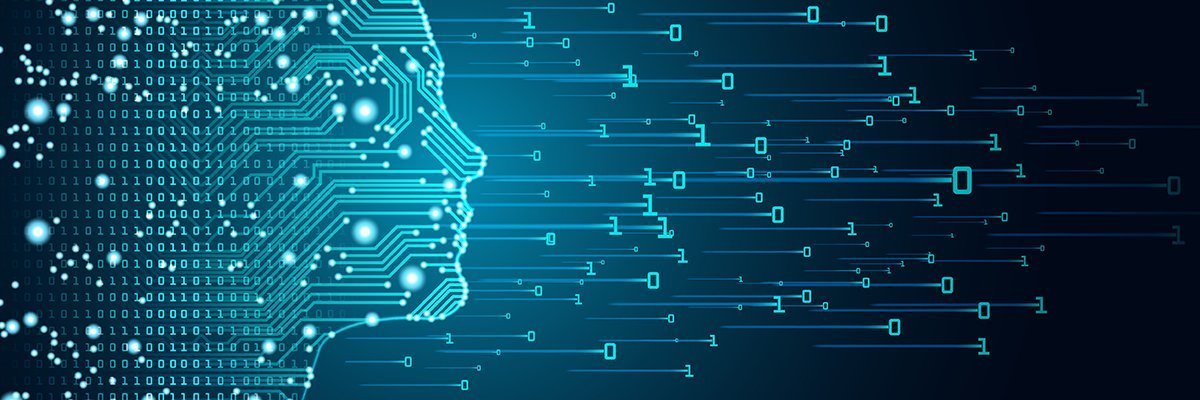THAWEERAT - stock.adobe.com
Warum die Angst vor PostgreSQL unbegründet ist
PostgreSQL erfreut sich zunehmender Beliebtheit, denn es bietet Vorteile gegenüber proprietären Lösungen. Viele schrecken allerdings vor einer Migration zurück. Das muss nicht sein.
PostgreSQL hat sich in den knapp 30 Jahren seit dem initialen Release als modernes Datenbankmanagementsystem (DBMS) etabliert, das sich durch seine Offenheit, Erweiterbarkeit und hohe Stabilität auszeichnet.
Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich aufgrund dieser Eigenschaften mit der Frage, ob eine Migration von bestehenden proprietären und Closed-Source-Systemen wie Oracle, Microsoft SQL Server oder Db2 zu PostgreSQL sinnvoll ist. Gründe für den Umstieg gibt es reichlich. Ein starker Faktor für Unternehmen sind zum Beispiel die geringen Betriebskosten: PostgreSQL ist Open Source, sodass sie keinerlei Zahlung von Lizenzgebühren in ihrem Budget einplanen müssen. Auch die Kosten für den Support sind dadurch wesentlich geringer als bei proprietären Systemen, denn die Community steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Wem das nicht reicht, für den gibt es alternativ aber auch professionelle Service-Anbieter, die Unternehmen bei Datenbankmigrationen oder der Inbetriebnahme von PostgreSQL zur Seite stehen und kontinuierlichen Support bei der Verwaltung und dem Betrieb bereitstellen.
Eine Datenbank nach Maß
Neben finanzieller Attraktivität sorgt das Open-Source-Modell auch für ein hohes Maß an Transparenz und Erweiterbarkeit. Die offizielle Weiterentwicklung von PostgreSQL bestimmt allerdings kein einzelnes Unternehmen, sondern die weltweite Community in enger Zusammenarbeit mit der PostgreSQL Global Development Group, die das Projekt offiziell steuert. Und da kein Teil des DBMS für Datenbankentwickler verschlossen oder unzugänglich ist, können User so eigene Ideen und Innovationen auf Wunsch umsetzen. Dadurch erhält das quelloffene Datenbankmanagementsystem meist sehr schnell neue Features, sobald der Bedarf bekannt wird.
Ein Blick in die Geschichte der Datenbanken
Die ersten Datenbankmodelle, die in grauer Tech-Vorzeit das Licht der Welt erblickten, waren streng hierarchisch: Daten wurden in einfachen Zeilen abgelegt, ohne dass Verbindungen oder Relationen zwischen ihnen bestanden. Der große Nachteil hierarchischer Datenbankmodelle ist die Organisation in strikten Baumstrukturen (Parent-Child-Beziehungen). Neue Anforderungen oder geänderte Beziehungen der Daten untereinander ließen sich nur schwer abbilden.
Diese mangelnde Flexibilität hat zur Folge, dass Daten oft mehrfach gespeichert werden müssen, um sämtliche Beziehungen abzubilden. Überdies ist der Zugriff auf bestimmte Daten nur dann möglich, wenn der gesamte Pfad bekannt ist. Das änderte sich Anfang der 1970er-Jahre, als der britische Mathematiker und Datenbanktheoretiker Edgar F. Codd, damals bei IBM beschäftigt, das relationale Datenbankmodell entwickelte. Aus einem der ersten relationalen Datenbankmanagementsysteme (RDBMS) namens Ingres ging schließlich PostgreSQL hervor. Dessen Entwicklung begann als universitäres Forschungsprojekt und wurde später in die Hände der PostgreSQL Global Development Group und der Community übergeben. Heute ist das Datenbankmanagementsystem Open Source und erfreut sich großer Beliebtheit.
Die Erweiterbarkeit von PostgreSQL endet jedoch dort noch lange nicht: Nutzer können auch eigene Datentypen einpflegen und Operatoren definieren, mit denen sie Daten filtern, vergleichen, kombinieren oder verändern können. Zudem gibt es ein großes Set an bereits vorhandenen Extensions, die JSON- oder KI-Funktionalitäten zugänglich machen. Fakt ist: viele Features, die heute in modernen Projekten gefragt sind, wurden in PostgreSQL bereits vor langer Zeit implementiert. Ein Beispiel ist etwa die Erweiterung pgvector, durch die User von PostgreSQL seit Jahren in der Lage sind, Vektordaten in ihrer Datenbank zu speichern. Für aktuelle KI-Anwendungsfälle wie Retrieval-augmented Generation (RAG), bei der Large Language Models (LLMs) Wissen aus Vektordatenbanken ergänzen, ist diese Erweiterung für PostgreSQL daher ein absolutes Must-have.
Unternehmen können PostgreSQL zudem schlank und modular betreiben. Die Basisinstallation umfasst lediglich die Kernfunktionen einer relationalen Datenbank, darunter Transaktionen, SQL-Unterstützung und ACID-Konformität (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ohne unnötige Zusatzmodule. Zusätzliche Funktionalitäten wie Geodatenverarbeitung, Vektorsuche oder Zeitreihen können Nutzer bei Bedarf über Extensions hinzufügen. Dieser modulare Ansatz ermöglicht Unternehmen, die Datenbank gezielt an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, leichtgewichtig zu halten und dennoch Szenarien wie Cloud-Betrieb, Containerorchestrierung in Kubernetes oder automatisierte CI/CD-Pipelines (Continuous Integration und Continuous Delivery) zu unterstützen.
Zwar gibt es Herausforderungen bei der Migration…
In den vergangenen Jahren wurde PostgreSQL auf Grund dieser Vorteile mehrfach vom renommierten Datenbankportal DB-Engines als DBMS of the Year ausgezeichnet. Doch so überzeugend die Gründe für PostgreSQL auch sind, ist eine Migration leider kein Selbstläufer. Denn obwohl alle großen relationalen Systeme auf denselben Grundlagen basieren, unterscheiden sie sich in Details zuweilen deutlich. Die größten Abweichungen gibt es beispielsweise bei Datentypen und Operatoren. Auch die SQL-Syntax für vorgefertigte Funktionen (Stored Procedures) und automatisch ausgeführte Reaktionen auf bestimmte Ereignisse (Trigger) unterscheiden sich von DBMS zu DBMS. Die Syntax der proprietären Abfragesprachen von Oracle (PL/SQL) und Microsoft (T-SQL) sind sehr spezifisch. PL/pgSQL, die Abfragesprache von PostgreSQL, orientiert sich hingegen stark an Standard-SQL. Solche Abweichungen müssen Unternehmen im Rahmen einer Migration berücksichtigen und ihre Standardabfragen entsprechend anpassen.
Viele IT-Landschaften sind zudem historisch gewachsen, was sich in starken Abhängigkeiten zwischen Anwendungen und Datenbanken widerspiegelt. Diese Dependencies erhöhen die Komplexität einer Migration, sodass die Umstellung eine sorgfältige Planung und ein strukturiertes Vorgehen voraussetzt. Da viele Unternehmen darüber hinaus strengen internen wie externen Regularien unterworfen sind, muss jede Änderung nachvollziehbar und prüfbar sein. Daher müssen sie auch bei einer Migration zu PostgreSQL sicherstellen, dass alle Compliance-Anforderungen erfüllt werden können und die Auditierbarkeit sowie Security-Standards gewährleistet sind.

„Neben finanzieller Attraktivität sorgt das Open-Source-Modell auch für ein hohes Maß an Transparenz und Erweiterbarkeit. Die offizielle Weiterentwicklung von PostgreSQL bestimmt allerdings kein einzelnes Unternehmen, sondern die weltweite Community in enger Zusammenarbeit mit der PostgreSQL Global Development Group, die das Projekt offiziell steuert.“
Oliver Stein, Redgate
Zu guter Letzt dürfen Unternehmen den Faktor Mensch nicht unterschätzen: Eine Datenbankmigration bringt immer auch organisatorische Veränderungen mit sich, weshalb es umso wichtiger ist, die Belegschaft frühzeitig abzuholen. Wer lange mit Systemen wie Oracle oder Microsoft SQL Server gearbeitet hat und mit deren Funktionsweisen vertraut ist, wird einem Umstieg auf PostgreSQL möglicherweise skeptisch gegenüberstehen.
…sie lassen sich aber bewältigen
Für eine gelungene Migration gibt es verschiedene Methoden und Ansätze. Unternehmen, die von SQL-Server-Umgebungen auf PostgreSQL migrieren wollen, haben es leicht. Es existieren nämlich Projekte wie Babelfish, die es PostgreSQL ermöglichen, die Sprache von SQL Server zu verstehen. Auf diese Weise können sie Anwendungen mit minimalen Anpassungen migrieren.
Für den Umzug von Oracle oder Db2 sind andere Ansätze erforderlich, beispielsweise die schrittweise Übersetzung von Stored Procedures. Grundsätzlich empfiehlt sich eine klare Trennung zwischen Schema- und Datenmigration, um Fehlerquellen zu minimieren. Mit Data-Masking-Tools können Unternehmen Testdatenbanken erstellen, die anonymisierte, aber konsistente Daten enthalten. So lassen sich regulatorische Anforderungen erfüllen, ohne dass Datenbankentwickler mit echten Kundendaten arbeiten müssen.
Um die Belegschaft abzuholen, bieten Pilotprojekte eine ideale Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, ohne direkt große Risiken einzugehen. Ebenso wichtig ist die Investition in Schulungen, um intern Kompetenz für PostgreSQL aufzubauen. Eine offene Kommunikation über Chancen und Veränderungen ist ebenfalls entscheidend, um Akzeptanz im Datenbankteam zu schaffen. Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, steht der Migration zu PostgreSQL nichts mehr im Wege.
Über den Autor:
Oliver Stein ist Geschäftsführer DACH bei Redgate.
Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.