
sabida - stock.adobe.com
Moderne Informationsarchitekturen: KI-fähig statt nur digital
KI-Projekte scheitern häufig an fehlender Informationsarchitektur. Unternehmen sollten daher besonders auf fünf Bereiche achten, um KI-fähig zu werden.
Viele Unternehmen in Europa haben künstliche Intelligenz auf ihrer Agenda ganz oben stehen. Pilotprojekte entstehen in Kundenservice, Vertragsprüfung oder Personalmanagement, die Erwartungen sind hoch: schneller Zugriff auf Wissen, effizientere Prozesse, bessere Entscheidungen. Doch häufig fehlt eine Informationsarchitektur, die Inhalte konsistent, auffindbar und im richtigen Kontext bereitstellt als Basis. Ohne diese Grundlage bleibt die Umsetzung vieler KI-Initiativen fragmentarisch.
Der European Digital Maturity Index (EDMI) 2025 verdeutlicht die Diskrepanz. Führungskräfte in der DACH-Region stufen ihre Unternehmen als innovationsbereit ein, gleichzeitig ist die Nutzung von Cloud-Content-Services und einheitlichen Informationsmodellen im europäischen Vergleich zurückhaltend. Die Folge: KI wird getestet, aber selten skaliert. Um das Potenzial auszuschöpfen, müssen Inhalte aber KI-bereit gemacht werden.
KI braucht mehr als Daten: Die fünf Säulen der AI-Readiness
Garbage in, Garbage out – dieser Satz bringt die Herausforderung auf den Punkt. Inhalte, die für den menschlichen Gebrauch erstellt wurden, sind für Maschinen nicht automatisch verständlich. Sie müssen vorbereitet, kuratiert und angereichert werden. Ausgehend von diesem Grundsatz lässt sich ein Framework mit fünf Säulen ableiten, die bestimmen, ob eine Organisation tatsächlich KI-fähig ist.
1. Infrastruktur
Technische Bereitschaft bedeutet mehr als leistungsstarke Server oder flexible Cloud-Modelle. Entscheidend ist eine Infrastruktur, die Daten sicher, skalierbar und kontextfähig macht. In der Praxis heißt das: Inhalte aus verschiedenen Quellen – Fachanwendungen, Kollaborationsumgebungen, ERP oder klassische Dokumentenablagen – müssen so verfügbar sein, dass KI-Systeme darauf zugreifen können, ohne bestehende Systeme komplett zu ersetzen.
Gerade in DACH-Organisationen mit gewachsenen IT-Landschaften ist dies ein zentraler Punkt. Föderation statt Migration ist das Gebot der Stunde. Inhalte bleiben in den Ursprungssystemen, werden aber zentral indexiert, mit Rechten versehen und einheitlich zugänglich gemacht. So entsteht ein Fundament, auf dem KI-Anwendungen realistisch aufgesetzt werden können.
2. KI-fähige Inhalte
KI kann nur so gut sein wie die Inhalte, die sie verarbeitet. Deshalb müssen Daten für Maschinen vorbereitet werden. Dazu gehört, Dokumente zu normalisieren, Texte und Bilder zu strukturieren, Metadaten zu generieren und semantische Repräsentationen anzulegen. Erst wenn Inhalte konsistent und angereichert vorliegen, lassen sich Suchergebnisse verbessern, Prozesse automatisieren oder KI-Agenten sinnvoll einsetzen.
Ein Beispiel: Ein Unternehmen möchte Vertragsdokumente automatisiert prüfen lassen. Werden die Inhalte zuvor in maschinenlesbare Formate überführt, Dubletten entfernt und zusätzliche Attribute wie Vertragsparteien oder Laufzeiten extrahiert, kann eine KI-Anwendung schnell relevante Klauseln identifizieren. Ohne diese Vorbereitung bleibt die Trefferqualität unzureichend – das Projekt verliert an Akzeptanz.
3. Governance
Governance ist mehr als Compliance-Haken. Sie bestimmt, ob KI sicher und verlässlich eingesetzt werden kann. Dazu braucht es klare Richtlinien für Zugriff, Klassifizierung, Aufbewahrung und Löschung von Inhalten. In einer AI-ready-Architektur werden diese Vorgaben von Anfang an berücksichtigt – idealerweise automatisiert und als Regeln im System hinterlegt.
Gerade in der DACH-Region ist das Thema entscheidend. Laut EDMI zählt die klare Steuerung von Informationen zu den größten Herausforderungen für Unternehmen. Wer KI einsetzen will, muss sicherstellen, dass sensible Daten zuverlässig erkannt und geschützt werden, dass Audit-Events nachvollziehbar bleiben und dass Ergebnisse mit Quellen belegt sind. Nur so lassen sich Risiken minimieren und Vertrauen schaffen.
4. Ethik
Neben Technik und Prozessen braucht AI-Readiness eine ethische Grundlage. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Fairness sind Anforderungen, die heute nicht nur Regulierungsbehörden, sondern auch Kunden stellen. KI-Modelle müssen so gestaltet sein, dass Entscheidungen erklärbar sind und unbeabsichtigte Verzerrungen erkannt werden können.
Unternehmen können dafür organisatorische Strukturen wie etwa ein internes Gremium, das KI-Nutzungen bewertet und Leitplanken setzt, aufbauen. Wichtig ist außerdem, dass Datenschutz nicht nachträglich ergänzt, sondern integraler Bestandteil jeder Architektur ist. Ethik bedeutet hier: Die Auswirkungen von KI aktiv steuern, nicht nur reagieren.
5. Fähigkeiten
Technik allein macht kein Unternehmen KI-fähig. Auch die Menschen müssen befähigt sein, KI sinnvoll einzusetzen. Das betrifft sowohl Fachbereiche als auch IT-Teams. Schulungen, einfache Bedienoberflächen und Low-Code-Ansätze helfen, Einstiegshürden zu senken. Ziel ist es, dass nicht nur Data Scientists, sondern auch Projektverantwortliche und Geschäftsanwender KI-gestützte Funktionen beurteilen, nutzen und verbessern können.
Gerade in Zeiten rarer Fachkräfte ist Weiterbildung entscheidend. Organisationen, die ihre Belegschaft aktiv einbinden, verhindern eine Spaltung zwischen wenigen Expertinnen und Experten und der Masse der Anwender. So wird KI zu einem Instrument, das in Prozessen verankert ist – nicht zu einer isolierten Spezialdisziplin.
Was bedeutet das für die DACH-Region?
Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen viel mit: ein hohes Sicherheits- und Compliance-Bewusstsein, klare Prozesse und eine gewachsene IT-Landschaft. Doch genau diese Stärken können auch zur Bremse werden, wenn neue Technologien zu vorsichtig eingeführt werden. Aktuell ist die Bereitschaft zur Innovation zwar groß, gleichzeitig herrscht aber Zurückhaltung bei Cloud-Content-Services und KI.
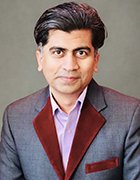
„Einheitliche Modelle, föderierte Zugriffe und klare Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen, Architektur und Datenschutz sind die Stellhebel, damit KI nicht in Pilotprojekten steckenbleibt, sondern in den Alltag übergeht.“
Arsalan Minhas, Hyland
Das bedeutet: Wer AI-ready werden will, sollte seine Stärken in Governance nutzen, aber bei Infrastruktur und Content-Services an Tempo zulegen. Einheitliche Modelle, föderierte Zugriffe und klare Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen, Architektur und Datenschutz sind die Stellhebel, damit KI nicht in Pilotprojekten steckenbleibt, sondern in den Alltag übergeht.
Fazit
AI-Readiness ist kein Schlagwort, sondern die Voraussetzung dafür, dass KI-Investitionen Wirkung zeigen. Die fünf Säulen – Infrastruktur, KI-fähige Inhalte, Governance, Ethik und Fähigkeiten – geben Unternehmen einen klaren Rahmen, um ihre Informationsarchitektur neu auszurichten.
Für die DACH-Region heißt das: Sicherheits- und Compliance-Stärken beibehalten, aber gleichzeitig konsequent an der Nutzbarkeit und Verfügbarkeit von Inhalten arbeiten. Erst wenn Daten, Prozesse und Menschen zusammenspielen, entsteht die Grundlage, auf der KI-Assistenten, Automatisierung und intelligente Suche verlässlich skalieren können. Dann wird aus digitalisiert tatsächlich AI-ready.
Über den Autor:
Arsalan Minhas ist seit der Übernahme von Alfresco durch Hyland im Jahr 2020 Teil des Unternehmens und verantwortet als AVP Sales Engineering die Teams in EMEA und APAC. Zuvor war er unter anderem als Software Architect sowie Director Solution Consulting bei internationalen Anbietern wie OpenText und Cordys tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Content Services, Digital Process Automation und Enterprise Information Management. Darüber hinaus leitet er das Alumni Chapter der Hamburg University of Technology (TUHH) in München. Als Speaker und Vordenker beschäftigt er sich insbesondere mit den Themen Innovation, Künstliche Intelligenz und digitale Transformation.
Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.






