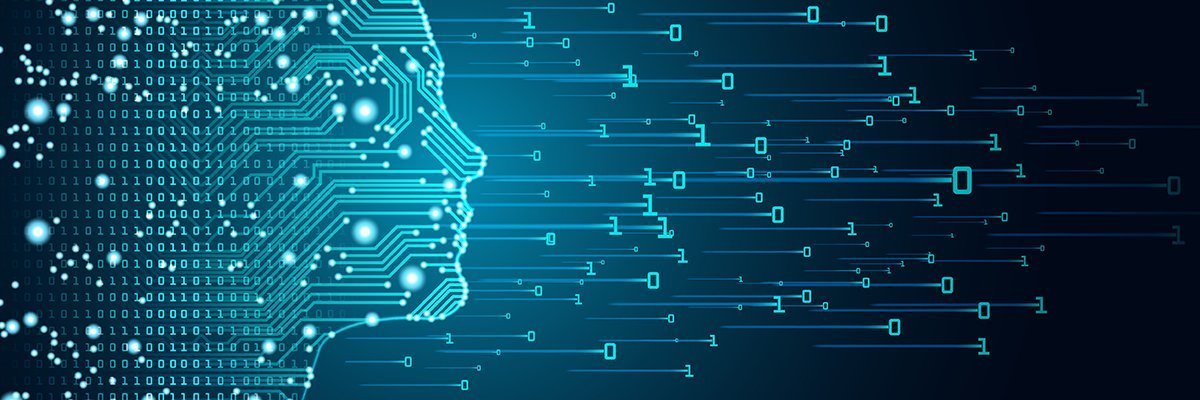Somboon - stock.adobe.com
Aktives vs. passives Netzwerk-Monitoring: Was ist besser?
Die zunehmende Nutzung von Clouds, virtuellen Systemen und verteilten Diensten erfordert neue Monitoring-Konzepte. Die Lösung ist ein Mix aus passiven und aktiven Methoden.
In der heutigen, stark digitalisierten Geschäftswelt ist eine zuverlässige Netzwerkleistung nicht nur wünschenswert, sondern geschäftskritisch. Unternehmen streben nach optimaler und konstanter Servicequalität durch durchdachtes Netzwerkdesign und vorausschauendes Performance-Monitoring. Die Realität moderner IT-Infrastrukturen, die von Virtualisierung, Multi-Cloud-Umgebungen und verteilten Systemen geprägt ist, macht jedoch die tiefgreifende Analyse der Netzwerkleistung zu einer komplexen Herausforderung für IT-Teams.
Die steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit setzen IT-Abteilungen enorm unter Druck. Sie müssen strenge Service Level Agreements (SLA) einhalten, um geschäftskritische Prozesse unterbrechungsfrei zu unterstützen. Dafür sind leistungsfähige Tools zur umfassenden Überwachung von Netzwerkverkehr und Systemkomponenten erforderlich, um Vorfälle frühzeitig zu erkennen und Fehler effizient zu suchen und zu beheben. Obwohl der Markt zahlreiche Lösungen für das Troubleshooting der Netzwerk-Performance bietet, erschwert gerade diese Vielfalt die Auswahl der optimalen Tools für die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens.
Grundlagen der Netzwerk-Monitoring-Strategie
Bei der Auswahl geeigneter Tools für das Troubleshooting der Netzwerk-Performance ist es zunächst wichtig, die allgemeinen Merkmale der Umgebung zu verstehen. Ist das Netzwerk beispielsweise direkt mit einer Partner- oder Drittanbieterumgebung verbunden? Gibt es Verbindungen zwischen Public Cloud und Private Cloud?
Für das Monitoring dieser Umgebungen stehen zwei grundsätzliche Ansätze zur Verfügung. IT-Fachleute können zwischen passivem und aktivem Traffic-Monitoring wählen, um Konfigurationsprobleme und andere Schwierigkeiten, die die Performance beeinträchtigen, zu ermitteln.
Passives Monitoring: Beobachten ohne Eingriff
Beim passiven Monitoring wird eine Paketerfassung verwendet, bei der der Traffic von einem Port per Netzwerk-Tap zu Trendberechnungen und Analysezwecken kopiert wird. Diese Methode bietet mehrere entscheidende Vorteile:
- Keine zusätzliche Netzwerkbelastung: Da kein zusätzlicher Traffic erzeugt wird, beeinflusst das passive Monitoring die Netzwerkleistung nicht.
- Echte Nutzungsmuster: Erfasst das tatsächliche Benutzerverhalten und reale Anwendungsmuster.
- Kontinuierliche Überwachung: Ermöglicht langfristige Trendanalysen und die Erkennung schleichender Probleme.
- Sicherheitsvorteile: Hilft bei der Identifizierung ungewöhnlicher Verkehrsmuster, die auf Sicherheitsbedrohungen hindeuten könnten.
Passives Monitoring ist besonders wertvoll, um das Netzwerkverhalten während Spitzennutzungszeiten zu analysieren, und liefert authentische Einblicke in das tatsächliche Nutzererlebnis.
Aktives Monitoring: Proaktive Problemerkennung
Aktives Monitoring erzeugt synthetischen Traffic im Netzwerk, um Routing-Probleme zu beheben und Black Holes sowie andere Probleme der Netzwerkleistung zu identifizieren. Als Black Hole wird ein Bereich oder eine Stelle im Netzwerk bezeichnet, an der eingehender oder ausgehender Datenverkehr ohne Benachrichtigung des Absenders verworfen oder gelöscht wird. Aktives Monitoring bietet folgende Vorteile:
- Proaktive Fehlererkennung: Identifiziert Probleme, bevor sie sich auf Benutzer auswirken.
- Gezielte Tests: Ermöglicht die Überprüfung spezifischer Netzwerkpfade und -komponenten.
- Baseline-Erstellung: Hilft bei der Festlegung von Performance-Standards für verschiedene Anwendungen.
- Echtzeit-Diagnose: Bietet sofortige Einblicke in aktuelle Netzwerkprobleme.
- Validierung nach Änderungen: Bestätigt die Wirksamkeit von Netzwerkänderungen oder -upgrades.
Bei der Implementierung von aktivem Monitoring sollte jedoch berücksichtigt werden, dass der zusätzlich erzeugte Netzwerkverkehr die Gesamtleistung beeinflussen kann – insbesondere in bereits stark ausgelasteten Umgebungen.
Der Hybrid-Monitoring-Ansatz.
Obwohl die Verfechter beider Vorgehensweisen darüber streiten, welcher Ansatz der richtige ist, können die meisten Organisationen in der Praxis von einer Kombination der beiden Methoden profitieren. Passives Monitoring erlaubt einen Blick auf die Aktivitäten und beobachtet Trends im zeitlichen Verlauf. Durch die Nutzung eines Echtzeit-Testmechanismus, den ein aktives Monitoring bietet, können IT-Abteilungen Probleme isolieren und Verbesserungen durchführen. Dies führt dazu, dass Probleme entschärft werden können.
Praxisnah formuliert: Aktives Monitoring zeigt, was schiefgehen könnte, passives Monitoring zeigt, was tatsächlich schiefgeht, und zusammen zeigen sie, wie man Probleme lösen kann.
Cloud-Integration und moderne Monitoring-Lösungen
Organisationen nutzen häufig eine Kombination aus Tools für On-Premises- und SaaS-Monitoring, um Aktivitäten in ihren Netzwerken zu verfolgen. Die SaaS-Produkte lassen sich erweitern, um Aktivitäten außerhalb der eigenen Firewall zu überwachen. Dadurch wird oft der Traffic in die Cloud und in andere Drittanbieter-Umgebungen beobachtet.
Moderne Monitoring-Lösungen integrieren zunehmend KI und maschinelles Lernen, um:
- Anomalien automatisch zu erkennen und zu klassifizieren.
- Vorhersagen über potenzielle Netzwerkprobleme zu treffen.
- Selbstlernende Baselines zu erstellen, die sich an veränderte Netzwerkbedingungen anpassen.
- Automatisierte Reaktionen auf erkannte Probleme zu ermöglichen.
Best Practices für ein effektives Netzwerk-Monitoring
Wie bei jeder Technologie muss die IT die Daten kontinuierlich überprüfen und bewerten, damit ein Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus einem Tool zum Troubleshooting der Netzwerk-Performance zieht. Darüber hinaus müssen IT-Abteilungen in regelmäßigen Abständen neu evaluieren, wie effektiv der Service sie beim Lösen von Problemen mit der Netzwerkleistung unterstützt, und die Servicequalität erhöhen.
Für ein optimales Netzwerk-Monitoring empfehlen sich folgende bewährte Praktiken:
- Strategische Platzierung von Monitoring-Punkten: Identifizieren Sie kritische Netzwerksegmente und Engpässe.
- Anpassbare Alarmschwellen: Konfigurieren Sie Benachrichtigungen basierend auf Ihrer spezifischen Umgebung.
- Regelmäßige Überprüfung der Monitoring-Strategie: Passen Sie Ihre Überwachungsansätze an veränderte Netzwerkanforderungen an.
- Dokumentation von Baseline-Metriken: Erstellen Sie Referenzwerte für die normale Netzwerkleistung.
- Integration mit ITSM-Prozessen: Verbinden Sie Monitoring-Daten mit Incident- und Problem-Management.
Fazit
Die Wahl zwischen aktivem und passivem Monitoring ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Ein umfassender Monitoring-Ansatz kombiniert beide Methoden, um sowohl reaktive als auch proaktive Einblicke in die Netzwerkleistung zu gewinnen. Durch die Integration moderner, KI-gestützter Analysetools können IT-Teams nicht nur aktuelle Probleme lösen, sondern auch zukünftige Herausforderungen vorhersehen und verhindern.
In der zunehmend komplexen Landschaft moderner Netzwerke, die Cloud-Dienste, Remote-Arbeit und IoT-Geräte umfassen, wird ein ganzheitlicher Monitoring-Ansatz zum entscheidenden Erfolgsfaktor für die Aufrechterhaltung einer optimalen Netzwerkleistung und Benutzererfahrung.
Dieser Artikel wurde ursprünglich von Amy Larsen DeCarlo verfasst und von der ComputerWeekly-Redaktion aktualisiert, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen und das Leseerlebnis zu verbessern.