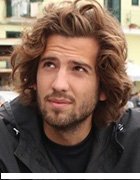abangaboy - stock.adobe.com
Quantenfehlerkorrektur: Verfahren und Herausforderungen
Die Quantenfehlerkorrektur erkennt und behebt Qubit-Fehler, die durch Interferenz und Dekohärenz verursacht werden. Sie ermöglicht fehlertolerante und skalierbare Quantencomputer.
Die reale Welt ist komplex und unvorhersehbar, selbst die zuverlässigsten Systeme sind anfällig für Fehler. In der Informationstechnologie ist der Umgang mit solchen Fehlern längst Routine: Fehlererkennung, -korrektur und -minderung sind wesentliche Bausteine, um die Zuverlässigkeit digitaler Systeme zu gewährleisten.
Auch klassische Computer sind nicht perfekt. Speicherzellen können ausfallen, kosmische Strahlung kann Bits umkehren, Stromschwankungen können Fehler verursachen. Fehlerkorrekturcodes (Error Correction Code), beispielsweise Hamming- oder Reed-Solomon-Codes, sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass diese Fehler erkannt und in Echtzeit korrigiert werden.
In der Quantenwelt dagegen ist die Situation deutlich komplexer. Qubits, die Grundbausteine der Quanteninformation, sind in der Regel nichts anderes als geladene Atome und extrem empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. Sie existieren nicht nur als 0 oder 1, sondern in einer Überlagerung beider Zustände. Schon minimale Störungen können diesen fragilen Zustand zerstören – ein Phänomen, das als Dekohärenz bezeichnet wird.
Die Eigenschaften ihrer subatomaren Teilchen wie Elektronen, Protonen und Neutronen existieren in einer vorhersehbaren Anordnung, die als Spin bekannt ist. In der Praxis basieren Qubits jedoch nicht ausschließlich auf geladenen Atomen, sondern auf unterschiedlichen physikalischen Plattformen, etwa supraleitenden Schaltkreisen, gefangenen (trapped) Ionen, Photonen oder Spins in Halbleitern. Diese Systeme nutzen quantenmechanische Freiheitsgrade wie Energiezustände, Phasen oder Polarisation, um Information zu speichern.
Darüber hinaus zeigen diese Teilchen innerhalb ihrer selbst und gegenüber anderen Teilchen ein zuverlässiges Verhalten, eine Eigenschaft, die als Kohärenz bezeichnet wird.
Qubits werden durch Störungen aus den Mechanismen von Quantenlogikgattern beeinflusst – wie Laserenergie, Mikrowellenstrahlungspulse und geformte Magnetfelder. Diese von Menschen entwickelten Quantenlogikgatter sind jedoch unvollkommen. Störungen durch andere Elemente der realen Welt – wie andere Atome und subatomare Teilchen oder sogar Hindernisse durch physische Objekte – können das Qubit verändern, Dekohärenz verursachen und zu Fehlern im Quantencomputing führen.
Was ist Quantenfehlerkorrektur und warum ist sie wichtig?
Quantenfehlerkorrektur (Quantum Error Correction, QEC) ist der Prozess der Erkennung von Quanteninformationsfehlern in Qubits, die durch Rauschen und Dekohärenz verursacht werden, und der Anwendung von Techniken zu deren Korrektur und Verhinderung. Dies trägt zur Herstellung zuverlässigerer Quantencomputersysteme bei.
Da eine direkte Messung eines Qubits dessen Zustand zerstören würde, nutzt QEC sogenannte Syndrommessungen. Dabei überprüfen spezielle Hilfs-Qubits (Ancilla-Qubits) den Zustand anderer Qubits, ohne deren Information zu löschen. So kann festgestellt werden, ob ein Fehler aufgetreten ist, und dieser mathematisch korrigiert werden.
QEC umfasst drei Schritte:
1. Kodierung: Die Quanteninformation wird über mehrere physikalische Qubits verteilt, die gemeinsam ein logisches Qubit bilden.
2. Syndrommessung: Ancilla-Qubits prüfen die Datenqubits, ohne sie direkt zu messen.
3. Korrektur: Auf Basis der Syndromdaten identifiziert ein Decoder den Fehler und korrigiert ihn.
Moderne Decoder setzen zunehmend auf maschinelles Lernen. Projekte von Google Quantum AI und ETH Zürich zeigen, dass KI-gestützte Decoder die Fehlerraten um bis zu 30 Prozent senken können.
Warum Quantenfehler entstehen
Das Verhalten der klassischen digitalen Logik ist in hohem Maße vorhersehbar und zuverlässig, da die digitale Logik in traditionellen, stabilen, logischen Zuständen – Einsen oder Nullen – existiert, die mithilfe herkömmlicher elektronischer Schaltungen unter der anhaltenden Wirkung stabiler Spannung und Stromstärke hergestellt und aufrechterhalten werden. Zwar können in digitalen Logikgeräten Fehler auftreten, doch sind diese relativ selten und leicht zu erkennen.
Quantenumgebungen sind weitaus empfindlicher. Die Hauptquellen von Quantenfehlern sind Rauschen, Dekohärenz und unpräzise Steuerimpulse (Gate-Fehler). Diese Effekte verändern den Quantenzustand schleichend oder abrupt. Darüber hinaus sind Qubits selten nur Einsen oder Nullen, sondern können gleichzeitig in einer Überlagerung beider Zustände existieren. Daher ist der Zustand, in dem das Qubit existiert, fragil und außerhalb eines Labors schwer aufrechtzuerhalten. Diese Faktoren stören Qubits leicht und führen zu Interferenzen und Dekohärenz, die den Quantenzustand des Qubits stören und Quanteninformationsfehler verursachen können. Es lässt sich zusammenfassen, dass klassische Bits stabile elektrische Zustände darstellen, Qubits hingegen sensibel auf Temperatur, elektromagnetische Felder und mechanische Vibrationen reagieren.
Drei Hauptursachen führen zu Quantenfehlern:
- Interferenz: Externe Einflüsse wie Wärme, Magnetfelder oder Schwingungen stören den Quantenzustand.
- Dekohärenz: Der Verlust quantentypischer Eigenschaften wie Überlagerung oder Verschränkung führt dazu, dass ein Qubit sich wie ein klassisches Bit verhält.
- Unvollkommene Quantengatter: Logische Operationen in Quantencomputern werden mit Lasern, Mikrowellen oder Magnetfeldern gesteuert – und diese sind nicht perfekt.
Quantenfehler treten also zwangsläufig auf. Entscheidend ist, wie man sie erkennt, kompensiert und korrigiert. Neben der Dekohärenz spielen heute auch Crosstalk (Wechselwirkungen zwischen benachbarten Qubits), Leckagefehler (Verlassen des Rechenraums) und Messfehler eine zentrale Rolle. In modernen Quantenprozessoren dominieren meist Gate- und Messfehler, die zwischen 10⁻³ und 10⁻⁴ pro Operation liegen.
Arten von Quantenfehlern
Es gibt verschiedene Arten, wie Quantenfehler entstehen. Zu den bekanntesten gehören unter anderem die folgenden:
- Bit-Flip-Fehler (X-Fehler): Der Zustand |0⟩ und |1⟩ wird vertauscht.
- Phasenfehler (Z-Fehler): Die relative Phase eines Qubits zwischen |0⟩ und |1⟩ verschiebt sich. Sie kehrt den Superpositionszustand des Qubits irgendwo zwischen eins und null um und wird auch als Phasenumkehrfehler bezeichnet.
- Y-Fehler: Kombination aus Bit-Flip und Phasenfehler.
- Gate- und Messfehler: Fehlerhafte Steuerimpulse oder ungenaue Auslesung eines Qubits.
- Kopplungsfehler und Crosstalk: Störende Wechselwirkungen zwischen benachbarten Qubits.
- Leckagefehler: Der Quantenzustand verlässt den definierten Rechenraum.
In der Praxis werden Bit-Flip- und Phasenfehler häufig zusammen als Pauli-X-, Pauli-Z- und kombinierte Pauli-Y-Fehler modelliert. Dieses vereinheitlichte Fehlermodell bildet die Grundlage der meisten QEC-Codes.
Die Bedeutung von QEC und fehlertolerantem Quantencomputing
Alle modernen Technologien sind ohne Zuverlässigkeit wertlos. Das einfache Vertrauen, dass der Betrieb und die Leistung jedes Geräts genaue und wiederholbare Ergebnisse liefern. Fehler können auftreten, aber die Techniken und Komponenten, die zur Erkennung und Korrektur von Fehlern eingesetzt werden, machen heutige Geräte nutzbar.
Quantencomputer sind unglaublich leistungsstarke und teure Systeme. Sie ermöglichen eine effektive Informationsverarbeitung, die mit herkömmlichen prozessorbasierten Computersystemen unmöglich wäre. Aber ohne eine Gewährleistung der Zuverlässigkeit wird kein Unternehmen und keine Behörde Quantencomputing für mehr als wissenschaftliche Neugierde nutzen.
Praktisches Quantencomputing erfordert die Implementierung von Fehlertoleranz (Fault Tolerance) und Fehlerkorrektur – insbesondere da Quantencomputer so skaliert werden, dass sie mit vielen Qubits gleichzeitig arbeiten können.
Fehlertoleranz bedeutet, dass ein Quantencomputer trotz vorhandener Fehler korrekt weiterrechnen kann. Das zugrunde liegende Threshold-Theorem besagt: Liegt die physikalische Fehlerrate unterhalb einer bestimmten Schwelle, kann durch QEC die logische Fehlerrate beliebig klein gemacht werden. Diese Schwelle liegt heute – je nach Code – zwischen 10⁻³ und 10⁻⁴.
QEC ist ein Teil der Antwort. Es implementiert eine Reihe verfügbarer Fehlerkorrekturcodes, um die Erkennung und Korrektur von Quantenfehlern in Echtzeit zu unterstützen. Fehlertoleranz baut auf QEC auf und trägt dazu bei, Quantencomputer-Designs zu liefern, die auch dann korrekt funktionieren, wenn Rechenfehler auftreten.
Quantencomputing wird eine Nischentechnologie bleiben, bis fehlertolerante und QEC-Technologien angewendet werden können, um vorhersehbare und wiederholbare Ergebnisse in realen Situationen auf einer großen Rechenebene zu gewährleisten.
Heute (Stand 2025) existieren bereits experimentelle Demonstrationen fehlerkorrigierter logischer Qubits bei IBM, Google und ETH Zürich. Die Technologie befindet sich also am Übergang von der Forschung in die frühe praktische Anwendung.
Quantenfehlerkorrektur vs. Quantenfehlerminderung
Die Begriffe Minderung (Mitigation) und Korrektur (Correction) werden manchmal synonym verwendet, aber es ist wichtig, zwischen ihnen zu unterscheiden.
Minderung. Minderung bedeutet, die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses zu verringern oder dessen Auswirkungen abzuschwächen. Quantenfehlerminderung (Quantum Error Mitigation, QEM) zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit von Quantenfehlern zu verringern oder die bestmöglichen Ergebnisse aus Quantencomputing-Ergebnissen zu erzielen, wenn Fehler auftreten.
Ein Teil der Quantenfehlerminderung besteht darin, sich mit dem Design von Quantengattern und der Handhabung von Qubits zu befassen. Beispielsweise können eine bessere Steuerung der Betriebstemperatur und eine überlegene Hardware zur Magnetfeldformung zu stabileren Qubits und geringeren Gatterfehlern führen.
Der andere Teil der QEM nutzt Techniken, um aus fehlerhaften Quanteninformationen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Dies geschieht mithilfe von Techniken für verrauschte Quanten auf mittlerer Skala, darunter die folgenden:
- Nullrauschextrapolation. Hierbei wird das Quantengatter unter verschiedenen Interferenzpegeln betrieben, bis der niedrigste Rauschpegel gefunden ist, der die besten Ergebnisse liefert.
- Probabilistische Fehlerkorrektur. Hierbei werden statistische Methoden eingesetzt, um die Auswirkungen von Interferenzen und Fehlern abzuschwächen.
- Messfehlerminderung. Diese Technik wird verwendet, um Fehler bei Quanteninformationsmessungen auszugleichen oder zu reduzieren.
Diese Ansätze sind besonders wichtig für Cloud-Quantenplattformen von IBM, Rigetti oder Quantinuum, wo Nutzer heute schon experimentelle Workloads ausführen können.
Korrektur. Korrigieren bedeutet, ein unerwünschtes Ergebnis zu ändern oder zu berichtigen. QEC zielt darauf ab, mehr Widerstandsfähigkeit in der Quanteninformation zu schaffen, damit der Quantencomputer Quantenfehler erkennen und manchmal auch korrigieren kann. Hier kommen die oben genannten drei Schritte des QEC (Kodierung, Erkennung, Korrektur) zum Einsatz.
Quantencomputer-Entwicklern stehen viele QEC-Code-Algorithmen zur Verfügung, von denen wir im Folgenden die wichtigsten beschreiben
Häufig eingesetzte QEC-Codes
Zur Quantenfehlerkorrektur wurden verschiedene Kodierungsverfahren entwickelt. Die wichtigsten sind:
- Shor-Code: Der erste vollständige QEC-Code (1995), der neun physikalische Qubits verwendet. Er kann beliebige Einzel-Qubit-Fehler korrigieren, ist jedoch für große Systeme zu ressourcenintensiv. Der Code wurde von Peter Shor entwickelt.
- Steane-Code: Ein Sieben-Qubit-Code, der Bit-Flip- und Phasenfehler gleichzeitig korrigieren kann. Der Steane-Code ist fehlertolerant, sodass der Fehlerkorrekturprozess keine zusätzlichen Fehler verursacht. Diese Eigenschaft macht den Steane-Code zuverlässiger und robuster als andere QEC-Codetypen.
- Surface Code: Der derzeit wichtigste Ansatz. Er nutzt ein zweidimensionales Qubit-Gitter, in dem Qubits nur lokal interagieren. Diese Architektur ist robust gegenüber lokalen Fehlern und bildet die Grundlage vieler moderner Quantenprozessoren von IBM, Google und Microsoft.
- Bosonische Codes: Sie nutzen die kontinuierlichen Zustände von bosonischen Systemen, wie sie in supraleitenden Resonatoren vorkommen. Varianten wie der GKP- oder der Cat-Code sind platzsparender und eignen sich besonders für hybride Quantenarchitekturen. Bosonische Codes 2025 wurden erstmals experimentell in Europa (ETH Zürich/PSI) nachgewiesen.
- Majorana-Codes (Hasting-Hash Code): Noch experimentell, aber potenziell besonders stabil, da sie topologisch geschützte Zustände verwenden. Dieser QEC-Code kann bei der Arbeit mit Majorana-Qubits bessere Kosten-Leistungs-Vorteile bieten als Oberflächencodes. Majorana-Qubits basieren auf exotischen Majorana-Fermionen, um stabile und robuste Qubits zu erzeugen. Oberflächencodes können für Gate-basierte Befehlssätze mit höherem Overhead effizienter sein.
- Five-Qubit-Code ([[5,1,3]]-Code): Der kleinstmögliche Code, der jeden beliebigen Fehler an einem einzelnen Qubit korrigieren kann. Er ist effizienter als der Shor-Code, aber in der Praxis oft schwieriger zu implementieren.
Wiederholungscode (Repetition Code). Ein einfacher QEC codiert ein einzelnes Daten-Qubit durch einfache Wiederholung in mehrere Qubits. Tatsächlich enthält jedes wiederholte Qubit die gleichen Informationen. Wiederholungscodes können Bit-Flip-Fehler korrigieren, jedoch keine Phasen-Flip-Fehler. Ein gängiges Beispiel ist ein Drei-Qubit-Code, bei dem ein Daten-Qubit auf drei doppelte Qubits wiederholt wird. Dieser Code ist jedoch noch unvollständig und Teil der grundlegenden Idee anderer Codes. Er schützt nur vor einer Art Fehler. Der Steane- und der Surface-Code bauen auf ähnlichen Prinzipien dieses Codes auf, während der Shor-Code eine Kombination aus einem Phasen-Flip-Repetition Code und einem Bit-Flip-Repetition Code darstellt.
Herausforderungen auf dem Weg zur Fehlertoleranz
Die Quantenfehlerkorrektur ist entscheidend für den praktischen und zuverlässigen Betrieb von Quantencomputern. QEC codiert grundsätzlich Teile von Daten über viele physikalische Qubits hinweg, um ein einziges logisches Qubit zu erstellen. Jedes Qubit bietet Redundanz und kann auf Fehler überprüft werden. Fehler können dann korrigiert werden. Dennoch stehen Entwickler bei der Fehlerkorrektur auf Quantenebene vor erheblichen Herausforderungen, darunter die folgenden.
Komplexität
QEC vervielfacht die Anzahl der physikalischen Qubits, die von einem Quantencomputersystem verarbeitet werden. Dies erfordert eine Vervielfachung der Anzahl der Quantengatter und anderer Hardware, die zur Unterstützung des größeren logischen Qubits erforderlich sind, das die gleiche Menge an Quanteninformationen verarbeitet, die ein einzelnes physikalisches Qubit sonst transportieren würde. Diese Komplexität vervielfacht auch die effektiven Kosten für das Design, den Bau, den Betrieb und die Wartung des Quantencomputers.
Messfehler
Die Kodierung von Datenabschnitten über mehrere physikalische Qubits hinweg ist der Schlüssel zu Redundanz und QEC. Allerdings unterliegt jedes physikalische Qubit, das am logischen Qubit beteiligt ist, aufgrund von Interferenzen und Dekohärenz immer noch derselben Fehlerwahrscheinlichkeit. Das Auffinden von Fehlern in empfindlichen Quantenzuständen – ohne zusätzliche Fehler in diesen vielen zusätzlichen Qubits zu verursachen – stellt für Quanteningenieure eine gewaltige Herausforderung dar.
Codeauswahl
Die Wahl des QEC-Codes beeinflusst, wie Quanteninformationen über die verschränkten Zustände vieler Qubits dargestellt werden. Derzeit sind zahlreiche QEC-Code-Algorithmen verfügbar, aber der Surface-Code ist die beliebteste Art von QEC-Code. Dieser arbeitet mit einem 2D-Array von Qubits und fügen in der Nähe der Daten-Qubits Hilfs-Qubits hinzu, um die Fehlererkennung zu unterstützen, indem sie traditionelle Paritätsprüfungen effektiv nachahmen. Andere Ansätze für die Anordnung von Qubits erfordern möglicherweise andere QEC-Codes. Entwickler müssen das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe auswählen.
Zusätzliche Herausforderungen
Die oben genannten Fallstricke sind nicht die einzigen, die ein Unternehmen beachten muss, wenn es in Quantencomputing investieren möchte. Zu den weiteren Problemstellungen gehören unter anderem diese:
- Ressourcenbedarf: Ein einziges logisches Qubit erfordert derzeit 1.000 bis 10.000 physikalische Qubits.
- Leistungsfähige Decoder: Die Echtzeit-Fehlererkennung benötigt leistungsstarke klassische Recheneinheiten nahe der Quantenhardware.
- Hardwarestabilität: Nur wenige Plattformen erreichen Fehlerraten unter dem theoretischen Schwellenwert für stabile Logikoperationen.
- Standardisierung: Einheitliche Schnittstellen zwischen QEC-Software, Hardware und Controllern fehlen bislang.
- Energiebedarf: Supraleitende Systeme müssen auf Millikelvin-Temperaturen gekühlt werden, was hohe Energiekosten verursacht.
Der Trend geht daher zu effizienteren QEC-Architekturen, hybriden photonischen Ansätzen und integrierter Fehlerunterdrückung in der Hardwaresteuerung.
Forschungsentwicklung
Die Quantenfehlerkorrektur hat in den letzten Jahren entscheidende Proof-of-Principle-Fortschritte gemacht, die den Weg für die praktische Umsetzung ebnen:
- IBM demonstrierte 2023 erstmals eine Fehlersuppression in einem kleinen logischen Qubit.
- Google Quantum AI zeigte 2023, dass die Fehlerrate logischer Qubits mit der Systemgröße sinken kann.
- Führende Forschungsinstitute wie die ETH Zürich treiben die Entwicklung bosonischer Codes mit supraleitenden Resonatoren voran.
- Förderprogramme wie DARPA und das EU Quantum Flagship investieren in die Entwicklung von KI-gestützten Decodern für Echtzeit-Fehlerkorrektur.
Das Erreichen von langlebigen logischen Qubits und fehlertoleranten logischen Operationen auf einem Niveau, das für praktische Anwendungen nötig ist, bleibt jedoch das zentrale, noch nicht erreichte Ziel für die kommenden Jahre.
Quantenfehlerkorrektur-Technologie
Hardware- und Software-Tools für die Quantenfehlerkorrektur entwickeln sich rasch, da Quantencomputing zunehmend Aufmerksamkeit und Investitionen auf sich zieht. Zu den wichtigsten Elementen, die in QEC zum Einsatz kommen, gehören die folgenden:
- Quantenfehler-Decoder. Quantenfehler-Decoder sind Prozessoren, die entwickelt wurden, um die Informationen von verrauschten Qubits zu filtern und Rauschen zu entfernen, um die Integrität der zugrunde liegenden Quanteninformationen zu bewahren und die Berechnung ausführen zu können. Solche Decoder sind für fehlertolerantes Quantencomputing von zentraler Bedeutung und stützen sich auf QEC-Kodierung und Ancilla-Qubits, um Rauschen von Daten zu isolieren.
- Quanten-Firmware. So wie die Firmware herkömmlicher Digitalcomputer die Lücke zwischen Hardware und Betriebssystemen und Software schließt, verbindet Quanten-Firmware die mathematischen Abstraktionen von Quantenalgorithmen mit der praktischen physikalischen Steuerung der Hardware, die die Qubits manipuliert. Entwickler sind zunehmend daran interessiert, Quanten-Firmware zu vereinheitlichen oder zu standardisieren, um bewährte Methoden für Qubit-Operationen mit hoher Abstraktion und minimalem Benutzereingriff bereitzustellen.
- Quanten-Dynamikstabilisierung (Quantum Dynamic Stabilisation). Viele Quantensysteme sind von Natur aus instabil und dekoherieren schnell in unerwünschte Zustände. Die Quanten-Dynamikstabilisierung ist eine Reihe von Techniken, die das Qubit periodisch manipulieren, um destabilisierenden Effekten entgegenzuwirken und das Qubit in einem gewünschten Quantenzustand zu stabilisieren. Solche Technologien sind von zentraler Bedeutung für die Fehlerminderung, da sie die Qualität der Qubits verbessern und somit die Wahrscheinlichkeit von Fehlern von vornherein verringern.
- Quantenfehlerunterdrückung. Die Quantenfehlerunterdrückung (Quantum Error Suppression, QES) baut auf der Quantenfehlerminderung auf. Sie zielt darauf ab, Hardwarefehler in Quantencomputern zu reduzieren, indem sie bessere Quantenkontrolltechniken entwickelt und die Widerstandsfähigkeit der Steuerungshardware verbessert – wodurch Quantenfehler effektiv verhindert werden, anstatt sie erst nach ihrem Auftreten zu erkennen und zu korrigieren. Die Quantenfehlerunterdrückung umfasst häufig die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Quantenhardware, die präzisere Steuerimpulse oder dynamische Rückkopplungstechniken ermöglicht. Beispiele für die Quantenfehlerunterdrückung sind dynamische Entkopplung, Quantenrückkopplungssteuerung und prädiktive, auf maschinellem Lernen basierende Quantenfehlerunterdrückung (MLQES).
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Techniken oft komplementär sind und sich nicht gegenseitig ausschließen. Beispielsweise ergänzt QES die QEC, und beide Techniken können in derselben Quantencomputerkonstruktion implementiert werden.
QEC auf einen Blick: Fehlertoleranz als Voraussetzung für den Durchbruch
Quantenfehlerkorrektur ist keine theoretische Spielerei, sondern die Grundvoraussetzung für praxistaugliches Quantencomputing. Erst wenn Quantenprozessoren in der Lage sind, Fehler zu erkennen und zu kompensieren, lassen sich komplexe Rechenaufgaben zuverlässig lösen.
2025 markiert den Beginn dieser neuen Ära: Die ersten stabilen logischen Qubits zeigen, dass fehlertolerantes Quantencomputing keine ferne Vision mehr ist.
Für IT-Entscheider, Cloud-Architekten und CIOs bedeutet das: Die Grundlagen für den Betrieb und die Integration von Quantenressourcen sollten schon jetzt geschaffen werden – auch wenn der Weg zur industriellen Reife noch einige Jahre dauern wird.